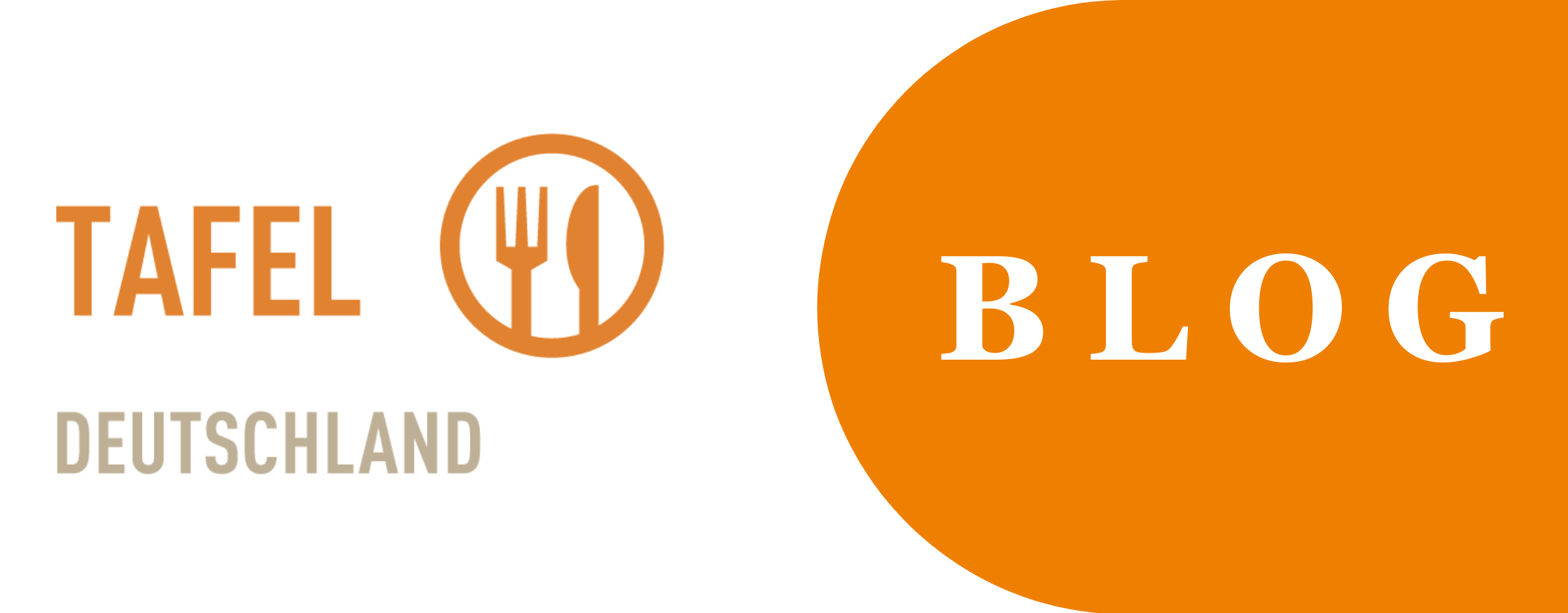© Philip Wilson
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Nico Dragano, Professor für Medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Düsseldorf.
Die COVID-19-Pandemie hat Schwachstellen unserer gesellschaftlichen Organisation ins Licht gerückt. Eine davon ist der Umgang mit sozialer und ökonomischer Benachteiligung und deren gesundheitlichen Folgen.
Bereits vor der Pandemie war ein Leben in Gesundheit auch eine Sache des Geldbeutels, des „richtigen“ Wohnorts oder der „richtigen“ Herkunft. Die Beziehung zwischen Armut und Gesundheit steht in engem Zusammenhang. Das war bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts bekannt: Engagierte Ärzte wie Rudolf Virchow oder Medizinreformerinnen wie Florence Nightingale haben sich früh dafür eingesetzt, die Lebensbedingungen der armen Bevölkerung zu verbessern, um Krankheiten zu vermeiden. Denn Hunger, enge und unhygienische Wohnverhältnisse, gefährliche Arbeitsbedingungen und fehlender Zugang zu ärztlicher Versorgung waren Haupttreiber der damals grassierenden Infektionskrankheiten, die für den Hauptteil aller Todesfälle verantwortlich waren.
„Kinder, deren Familien materiell benachteiligt sind, haben schon von Beginn an schlechtere Gesundheitschancen.“
Prof. Dr. Nico Dragano
Diabetes, Krebs oder Demenz treffen Menschen in Armut am häufigsten
In modernen Gesellschaften sieht es nicht anders aus, auch wenn sich die Diagnosen geändert haben. Mittlerweile dominieren chronisch-degenerative Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Diabetes, Krebs oder Demenzen das Krankheitsgeschehen. Was aber all diese Diagnosen eint: Sie treffen Menschen in Armut am häufigsten. Die Gründe sind die gleichen wie vor 150 Jahren. Geld und Einfluss sind mit besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen verbunden. Die Wohnungen von wohlhabenderen Menschen sind größer, der Urlaub länger, das Essen gesünder und teurer, die Arbeitsbedingungen und Erwerbsaussichten besser. Diese Faktoren werden in der Forschung „soziale Determinanten der Gesundheit“ genannt und vermitteln zwischen dem ökonomischen Zustand „Armut“ und Gesundheit. Gleichzeitig darf sozioökonomische Ungleichheit der Gesundheit nicht auf den Kontrast Arm und Reich reduziert werden.
Auch Menschen, die nicht in Armut, dafür aber mit kleineren und mittleren Einkommen auskommen, haben statistisch gesehen mehr Krankheiten und versterben früher als Menschen in den obersten Einkommensklassen. Und noch ein weiterer Punkt ist wichtig: Betroffen sind alle Altersgruppen. Das bedeutet auch, dass in Deutschland nahezu alle Gesundheitsstörungen im Kindesalter sozial ungleich verteilt sind. Kinder, deren Familien materiell benachteiligt sind, haben schon von Beginn an schlechtere Gesundheitschancen.
Die Pandemie macht Probleme sichtbar

am Universitätsklinikum Düsseldorf.
Foto: Privat
All diese Probleme waren bereits vor der Pandemie bekannt. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die von vielen Akteurinnen und Akteuren seit langem geforderte politische Strategie zur umfassenden Bekämpfung dieser gesundheitlichen Ungleichheit in Deutschland entwickelt oder gar umgesetzt worden wäre. COVID-19 hat diesen Mangel schmerzlich spüren lassen. Im Verlauf der Pandemie verschoben sich die gesundheitlichen Belastungen immer mehr in Richtung benachteiligter Bevölkerungsgruppen. So waren in den pandemischen Wellen 2 und 3 die Fallzahlen in Gebieten mit niedrigem Einkommen deutlich erhöht. Gleiches gilt für das Risiko schwerer Verläufe bis hin zum Tod. Hier zeigte sich in Analysen großer Datensätze von Krankenkassen, dass Menschen mit Arbeitslosengeld II auf den COVID-19-Stationen der Krankenhäuser überrepräsentiert waren. Zugleich war die COVID-19-Sterblichkeit in ärmeren Gegenden höher als in reicheren. Soziale Determinanten spielen hier eine große Rolle. Infektionsrisiken steigen beispielsweise, wenn Menschen in engen Wohnungen und Wohnvierteln leben. Das betrifft zumeist Menschen mit geringem Einkommen. Ebenfalls spielen Faktoren wie Mobilität im Nahverkehr, aber auch berufliche Risiken eine Rolle. Viele der Berufe etwa, die während der Pandemie nicht im Homeoffice ausgeübt werden konnten, sind zugleich Berufe in Branchen wie der Altenpflege oder Fleischindustrie, die für ihre niedrigen Löhne bekannt sind. Sterberisiken wiederum hängen wahrscheinlich mit dem allgemein schlechteren Gesundheitszustand von sozioökonomisch benachteiligten Menschen zusammen. Neben Ungleichheiten bei Infektionen und Verläufen hat die Pandemie aber noch weitere Belastungen mit sich gebracht, die wiederum ein soziales Muster aufweisen. Alltagssorgen, Homeschooling in beengten Wohnungen, Angst vor einem Jobverlust oder der tatsächliche Jobverlust: Psychische Belastungen treffen bestimmte soziale Klassen häufiger.
Gesundheitliche und soziale Ungleichheiten als ein gemeinsames Problem behandeln
Das Pandemie-Management hätte die soziale Dimension von Beginn an berücksichtigen müssen. Weitreichende und ernsthafte Schritte wären nötig gewesen. Sinnvoll wäre zum Beispiel, in den Entscheidungsgremien regelhaft Expertinnen und Experten für die öffentliche Gesundheit (Public Health) mit einzubeziehen. Dies gilt für alle Ebenen – von den Kommunen bis zum Bund. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten auf eine sozial ungleiche Wirkung hin geprüft und ggf. Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen. Teilweise ist dies geschehen, etwa im Falle des Kurzarbeitergeldes. Das sind allerdings eher Ausnahmen als die Regel. Als besonders schwerwiegend hat sich herausgestellt, dass die Gesundheitsämter in der Vergangenheit immer weiter ausgedünnt wurden. Gemeint ist hier nicht die Kontaktverfolgung, sondern der Umstand, dass in den Kommunen ein wichtiger Beitrag zur soziallagenbezogenen Prävention geleistet wird, der in der Pandemie aufgrund der fehlenden Ressourcen kaum aufrechterhalten werden konnte. Klar ist auch, dass eine angemessene Reaktion nicht aus Einzelmaßnahmen bestehen kann. Es braucht ein strategisches Vorgehen, politischen Willen und finanzielle Investitionen, mit dem Ziel, gesundheitliche und soziale Ungleichheiten als ein gemeinsames Problem zu behandeln und zu verringern. Diese Aufgabe sollte sofort und nicht erst in der nächsten Gesundheitskrise erledigt werden.
Dieser Beitrag erschien im Tafel-Magazin 2021.